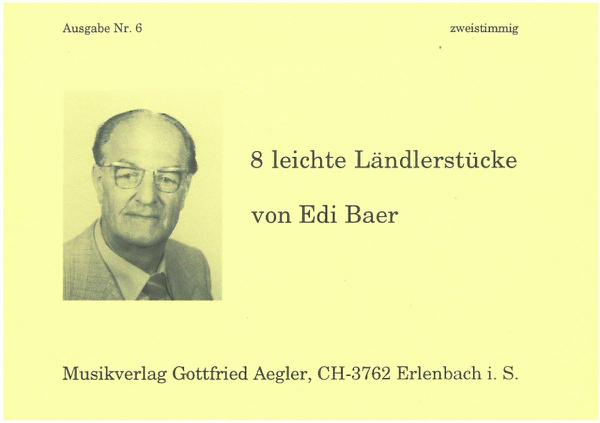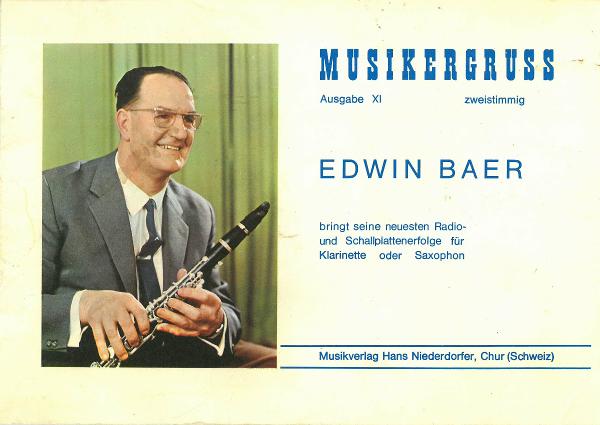Edi Bär
Weitere Namen
Andere: Edy Bär Bürgerlicher Name: Edwin Bär Andere: Edi BaerDaten
*17.10.1913 Oetwil am See ZH, +11.2.2008 Männedorf ZHInstrumente
Klarinette SaxofonOrte
Männedorf, Zürich, SchweizBiografie
Während der Nachkriegszeit bis um 1970 der bedeutendste der Ostschweiz entstammende Ländlerklarinettist, dessen beinahe 500 veröffentlichten Tänze neben jenen von Jost Ribary sen. zu den meistgespielten zählen. Als jüngster Sohn einer Bauernfamilie mit drei Kindern im Weiler Chrüzlen bei Oetwil am See, unweit des Zürichsees, geboren und aufgewachsen, liess er sich als Achtjähriger von seiner Klassenlehrerin in das Mandolinenspiel einführen. Mit zwölf Jahren ermöglichten ihm seine Ersparnisse den Ankauf einer Klarinette, worauf er nach kurzem Selbstunterricht als Sechstklässler bereits mit einem Solo in der Kirche von Oetwil hervortrat und bald danach in die Harmoniemusik Egg aufgenommen wurde. Eine Lehre als Instrumentenmacher bei Musik Hug in Zürich blieb ihm verschlossen, da eine solche nur Stadtbewohnern zugänglich war. Stattdessen trat er nach Schulende 1929 in die Chemische Fabrik Uetikon ein, lernte Schlosser und hielt diesem Unternehmen über fast drei Jahrzehnte die Treue. Seine Tanzmusiker-Laufbahn eröffnete er als Siebzehnjähriger am 1. Oktober 1930 im "Sternen" Oetwil am See aus Anlass der Kilbi. Ihm als Bläser zur Seite standen Ruedi Brüngger, Handorgel, und der 1962 verstorbene Rütemer Ernst Beglinger, Bassgeige. Achtzehnjährig wurde er Schüler am Konservatorium Zürich, liess sich dort während zwei Jahren von Emil Fanghänel in Klarinette ausbilden, fasste indessen schon früh den Entschluss, die Musik lediglich als Nebenbeschäftigung auszuüben. Auch stand bereits fest, dass er sich nicht allein der Volksmusik verschreiben, sondern sich auch anderen Musikarten öffnen würde. So hörte er mit Vorliebe berühmten Unterhaltungsorchestern wie "Marek Weber" zu, als diese in Zürich gastierten. Selber näherte er sich zusehends der klassischen Musik, pflegte aber gleichzeitig innerhalb des Ensembles von Ciano Caprani in Zürich eine Weile den Swing und den Jazz, ohne sich freilich von der Volksmusik loszusagen. Volljährig geworden, bot er erstmals am Radio 1933 unter "Ländlerkapelle Edwin Bär" Eigenkompositionen dar. Solche Erstlingswerke wie den Walzer "Eine Nacht in Lugano" oder den Fox "Mondscheinnacht" spielte er 1936 für den Produzenten Rosengarten in einer alten Fabrik in Wädenswil auf Schallplatte der Marke "Elite Record" ein. Neben Brüngger, Beglinher beschäftigte er öfters den Akkordeonisten Franz Kessler und den Klavierspieler Gusti Böhni in seiner auf hohem Niveau stehenden Amateurformation. Mittlerweile war er der Harmoniemusik "Verena" Stäfa beigetreten, in der er von 1933 bis 1945 mitwirkte und die er gar von 1940 bis 1944 dirigierte. Seine Vorliebe für die Ländlermusik wuchs mit dem Anhören so vorbildlicher Klarinettisten wie Jost Ribary sen. und Dominik Märchy, was sich bei ihm in einer regen Betätigung als Interpret und Komponist von Volksmusik kundtat. Bedeutsam für den weiteren Verlauf seiner Karriere wurde das Jahr 1941, als er sich mit neuen Musikern umgab, zu denen der Rapperswiler Ernst Kuratli zählte, der ihm jahrzehntelang zu Diensten stand. Sein beachtliches Können, das sich aus einer guten Grundschulung und fortgesetzten Musikstudien herleitete, trat auch durch seine Mitwirkung bei Kirchenkonzerten sowie etliche seiner Kompositionen ernster Richtung, so ein 30-minütiges, dreisätziges Konzert für drei Sopransaxophone, zutage. Die gepflegte feine Spielart in Verbindung mit der Neuerung, dem Akkordeonisten eine zweite Stimme mittels des Flötenregisters zuzuweisen, gereichte zwar nach dem Urteil kritischer Stimmen der Ländlermusik eher zum Nachteil, da sie mit einem Verlust an Unmittelbarkeit und Ursprünglichkeit einherging. Nach seiner Verheiratung 1942 übersiedelte Bär nach Uetikon, worauf er sich 1946 in Männedorf niederliess und auf Initiative von Musikdirektor J.H. Müller, verstorben 1959, in die Harmoniemusik Wädenswil übertrat, der er während rund zehn Jahren angehörte. Er festigte in der Nachkriegszeit seinen Ruf als herausragender Ländlerinterpret durch unzählige Radiosendungen und Plattenaufnahmen, holte 1950 Lydia Sprecher und 1956 Bobby Zaugg in seine Formation, die ihn 1964 an die Weltausstellung in Kanada begleiteten, und bildete Ausgangs der 1960er-Jahre mit Röbi Pfister, Posaune, und Ernst Plattner, Klavier/Bass - sie ersetzten Tobi Heeb und Alois Lindauer -, neben Ernst Kuratli eine neue Standardkapelle. Von sich Reden machte er um 1970 durch die volkstümlichen Tanzabende im Zürcher Dancing "La Ferme", seine experimentierfreudige Zweitformation "Bärentatzen" und die Langspielplatte "Grüeziwohl Brazilia", die Ländlerklänge vermischt mit Elementen der brasilianischen Volksmusik anbot. Der passionierte Sportschwimmer, der in manchen Ländern Europas und in Übersee konzertiert hat und dessen beliebteste Eigenkomposition der Schottisch "Pure-Chilbi" ist, war im Verlauf der letzten 28 Jahre vor seiner Pensionierung hauptberuflich als Aussendienstmitarbeiter im Bereich Metallurgie tätig. Seit 1964 bewohnte er ein Eigenheim auf dem Allenberg ob Männedorf. Er war noch in den 1980er-Jahren aktiver Ländlermusikant.Objekte