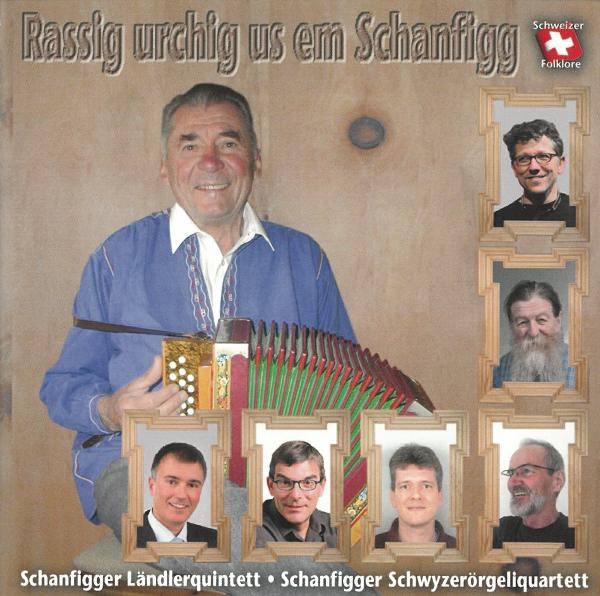Pauli Kollegger
Weitere Namen
Bürgerlicher Name: Paul KolleggerDaten
*21.11.1872 Obervaz GR, +27.3.1927 Accla/Valbella GRBeruf
PostillionInstrumente
KlarinetteBiografie
Klarinettist, der vielleicht als der bemerkenswerteste und ebenso merkwürdigste unter den Stammvätern der Bündner Volkstanzmusik gelten kann, sowohl angesichts seiner Lebensumstände, die dem Bild des fahrenden Musikanten gleichen, als auch wegen der Ursprünglichkeit und der Eigenart seiner Tanzweisen. Aufgewachsen als Sohn der Arbeiters Hilarius Kollegger auf der Lenzerheide, verdiente er sich sein Brot anfänglich als Waldarbeiter und Holzfäller, teils in der näheren Umgebung, so im Gemeindegebiet von Parpan, teils auswärts, ja gar in Frankreich. Er muss schon damals ein ausgezeichneter Klarinettist gewesen sein, zumal berichtet wird, er habe in Frankreich Tanzmusik mit einem einzigen Trommler als Begleiter machen müssen. Neben dem Musizieren fand er sein Auskommen von 1895 bis 1905 als Postillon. So fuhr er als hervorragender Pferdekenner während dieser Zeit täglich die fünfspännige grosse Pferdepost von Churwalden nach Tiefenkastel und zurück, nicht ohne vom Posthorn ausgiebig Gebrauch zu machen. Seine Spielpartner warb er meist am Ort der Veranstaltung an, unterhielt also kaum jemals eine geschlossene Formation. Um die Jahrhundertwende, vor dem Aufkommen der Handorgel, die bald darauf der Geige als Begleitinstrument den Rang ablief, trat er vorzugsweise in der 4-Mann-Besetzung mit Klarinette, zwei Geigen und Kontrabass auf. Lai, Valbella und Parpan dürften die hauptsächlichsten Spielorte gewesen sein. Die dreisaitige Bassgeige bediente gewöhnlich sein Bruder Johann Kollegger, freilich mehr um des Geldes willen denn aus Berufung, musste er doch wegen seines musikalischen Unvermögens mehrfach gerügt werden. Da beide Ehen Paul Kolleggers kinderlos blieben, nahm er den 1903 geborenen Sohn seiner Schwester, den Neffen Anton, zu sich, hielt ihn wie sein eigenes Kind und lehrte ihn Klarinette spielen. Später nahm er ihn als 2.Klarinettisten zum Aufspielen mit, wobei nun für die Begleitung, ausser dem Streichbass, gewöhnlich ein Handorgelspieler mit einer italienischen «Stradella»-Orgel oder auch ein Schwyzerörgeier beigezogen wurde. 1910 fand er in Trins mit der Übernahme der Ziegenhirtschaft einen andersartigen Haupterwerb. Zusammen mit seinem Neffen trieb er bei jeder Witterung an die 250 Ziegen auf die teils stunden. weit entfernten Alpen. Zählten früher etwa im Domleschg die seltsamerweise Vogel, Fink und Spatz geheissenen Musikanten zu seinen ersten Begleitern, so kam er in Trins mit der dortigen Ländlerdynastie Metzger («Seppli-Musik») in Berührung und machte im Prättigau mit Suter, auf der Lenzerheide mit Dosenbach, Paterlini, in Zorten mit der Familie Bergamin (genannt "Crieclis") und in Churwalden mit Hans Fischer (nicht Hans Fischer, Chur!) Musik. Zu seinen Getreuen zählten zeitweise auch der Davoser Klarinettist Geisler, der Schwyzerörgeler Leonhard Bergamin (älterer Bruder von Luzi Bergamin) sowie in späteren Jahren A. Heusser, ebenfalls Schwyzerörgeli. Noten und Tonartbezeichnungen waren ihm fremd, doch verfügte er nichtsdestoweniger über eine beträchtliche Anzahl eigener Tänze - schätzungsweise 150 Stück - sowie solcher bayerischer und österreichischer Herkunft. Daher vermochte er leicht eine Nacht lang ohne eine einzige Wiederholung auszukommen. Mit dem Begleiten seiner teils eigenartigen Kompositionen, von denen der Verlag Grossmann rund ein Dutzend zugänglich gemacht hat, sollen sich die Mitspieler oft schwergetan haben. Im Verlauf seiner Hüterzeit zog er sich eine Verletzung am linken Daumen zu, die sich zu einer Blutvergiftung auszuweiten drohte. Um das Schlimmste abzuwenden, entschloss sich der Arzt kurzerhand zur Amputation des für den Musikanten so notwendigen Glieds. Diesem dauernden Nachteil begegnete Kollegger später dadurch, dass er sein Instrument, die kleine hell tönende oder die grössere sonore A-Klarinette, schräg zum Mund hielt. Im bereits vorgerückten Alter besserte er seine Musikeinkünfte durch den Erlös aus anderen Tätigkeiten auf. So zog er an der Seite seines Pflegesohns und seiner zweiten Frau Agnes (Nesa) mit einem eigenen Pferdefuhrwerk, einem Bogenwagen, durch die umliegenden Bündner Täler, handelte mit Altmetall, Geschirr und Pferdedecken, feilte Sägen und schliff Messer und Scheren. Als Nachtlager diente ihm irgendwo ein Heustock, den Wein und die Esswaren kaufte er beim Händler ein. Als gewinnbringend erwies sich der Handel mit Lumpen und Knochen, dem er sich schliesslich vermehrt zuwandte. Die Ware setzte er in Chur, bei der sogenannten Knochenmühle, nahe beim «Schützengarten» ab. Als Knecht diente er auch eine Weile dern Wirt des Gasthofs «Kreuz» in Malix. Eine Zeitlang soll er ebenfalls in der Brauerei in Chur als Fahrtknecht gearbeitet haben. Sein freies Dasein und den rastlosen Wechsel der Berufe hat er einmal so begründet: «Ach, was bruucht dar Pauli Gält, dVögel hän au kais! Für hüt hämmar no, mora kömmar widar luaga»» Der starke, eher schweigsame und ernste Mann, der um seiner Freundlichkeit und Tugend willen überall Wohlwollen genoss, der Jenisch und Deutsch, jedoch nicht Romanisch sprach, erlag innert ein paar Tagen einer Lungenentzündung, als Folge einer Grippe oder auch bloss einer Erkältung, an der er im Vorfrühling 1927 erkrankt war. Er wurde in Zorten bestattet. Seine wohl schönsten Melodien dürfte er mit ins Grab genommen haben.Objekte